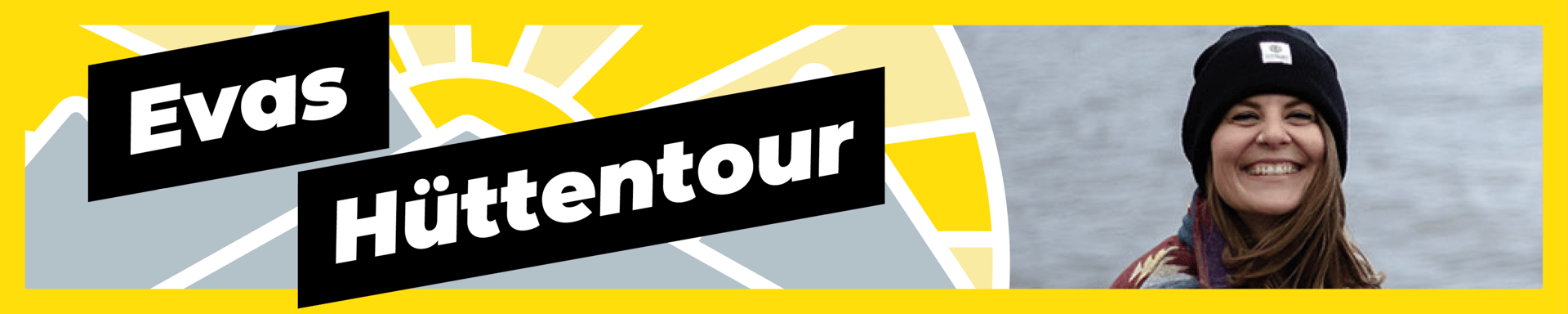Kneifelspitze
Der Watzmann auf dem Silbertablett
Von der Kneifelspitze in Berchtesgaden hat man den wohl besten Rundblick in den Talkessel, auf die Berchtesgadener Alpen und bis weit ins Salzburgerische hinein – und das ganz ohne langen Aufstieg. Ein Logenplatz mit langer Tradition.
Kurz aber knackig ist er, der klassische Aufstieg vom Parkplatz oberhalb der Kirche in Maria Gern zur Paulshütte auf der Kneifelspitze. Es geht über schmale, steile Pfade, Schotterstraßen und insgesamt 20
Serpentinen durch den Wald. Nach gut vierzig Minuten sind 2,12 Kilometer und 352 Höhenmeter geschafft. Manche brauchen für die Strecke nicht mal eine halbe Stunde, andere wandern gemütlich eine bis eineinhalb Stunden nach oben, machen Rast auf einer der vielen Holzbänke und genießen die Aussicht. Die Kneifelspitze gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Berchtesgaden und weit über die Grenzen des Talkessels hinaus. Einheimische kommen zum Feierabend auf die „Kneife“, Familien nutzen sie als Wanderziel am Wochenende, ebenso Ausflügler aus den umliegenden Landkreisen sowie dem benachbarten Salzburg. Nicht zu vergessen die vielen Urlauber, die den verhältnismäßig kurzen Weg schätzen, der sie zu einer der besten Aussichtsplattformen im gesamten Talkessel führt. Und dann sind da natürlich die Trailrunner, die die kurze Strecke für eine schnelle Trainingseinheit nutzen.


An diesem lauen Spätnachmittag Ende April ist nicht mehr viel los. Die Sonne steht noch weit oben am Horizont während Uli Datz ihre letzten Gäste in der Paulshütte bewirtet. Der größte Ansturm ist vorbei, die Osterfeiertage liegen schon ein paar Tage zurück. Sie räumt die Gläser in die Spülmaschine, die die Gäste auf der Theke abstellen, bevor sie gehen. Im Gasthaus gilt Selbstbedienung. Auf der Terrasse sitzt ein Pärchen bei einem Glas Wein, ein anderer Gast lässt sich den selbstgemachten Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne und dazu ein Weißbier schmecken.
Inhaberin Uli Datz arbeitet hier auf 1.189 Metern Höhe, seit sie denken kann. Das gesamte Plateau inklusive der Hütte befindet sich im Privatbesitz der Familie Datz. Uli’s Vater Franz kaufte das Areal 1972 und baute es aufwendig um. Zu der Zeit war Uli gerade einmal drei Jahre alt. Heute gibt es dort, wo früher nur eine kleine Holzhütte mit zwei Tischen und ein paar Stühlen stand, zwei große Sonnenterrassen mit dem wohl schönsten Blick auf den Watzmann sowie eine große Gaststätte.
Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Koch Sigi kümmert sich Uli Datz jeden Tag um die Gäste. Einen festen Ruhetag gibt es nicht. Auch Angestellte haben die beiden keine. Manchmal helfen Schwester, Neffe oder andere Familienmitglieder aus. Und das passiert nicht selten, wenn die Hütte von Ende März bis Oktober jeden Tag geöffnet hat. „Außer wenn es draußen wirklich grausig ist und eh keiner kommt, dann sperren wird nicht auf“, sagt Uli.
Je nach Witterung öffnen sie sogar während der Weihnachtsfeiertage. „Wir befinden uns hier in einer Premiumlage. Haben das ganze Jahr durchgehend von früh bis spät Sonne und bei uns sind die Wege schnell gut begehbar, trotz Schnee. Da kommen viele rauf, wenn es zum Skifahren oder Tourengehen noch nicht oder nicht mehr reicht“.
Früher hat Papa Franz die Forststraße immer selbst mit dem Unimog geräumt. Das sei für ihn das Größte gewesen, bei Sauwetter den Weg frei machen, oben einheizen und dann warten, bis jemand vorbeikommt, erzählt Uli. „Heute rechnet sich das nicht mehr. Wir haben zwar eine Solaranlage, heizen aber mit Gas. Das Haus ist in erster Linie für den Sommer gebaut und man bräuchte zu viel Energie, um alles warm zu bekommen. Außerdem müsste ich jede Fahrt mit dem Schneepflug bezahlen. Das steht nicht dafür. Und wir brauchen einfach unsere Ruhephase“.

Alles in Handarbeit
Die Geschichte der Paulshütte begann für Uli Datz 1972. Tatsächlich liegt sie aber noch viel weiter zurück. Bereits 1885 befand sich unterhalb des Gipfels ein kleiner Holzunterstand, an dem sich Wanderer und Holzarbeiter ausruhen konnten. Das Geld dafür kam von einem gewissen Paul Bartsch, dem die Hütte und heutige Gaststätte ihren Namen verdankt. 1928 bauten die drei Schwestern Karolina, Resi und Leni Moderegger vom Bauernhof Kneifellehen – 250 Meter unterhalb der Kneifelspitze – eine Holzhütte auf den Gipfel. Dort verkauften sie die Getränke an durstige Wanderer, die sie mit ihrem Maultier hinauf transportierten. Als sie damit genug Geld gesammelt hatten, konnten sie eine robustere Blockhütte errichten. Während des zweiten Weltkriegs befand sich hier oben eine Flugabwehr. Schließlich reicht der Blick weit, sodass man Feinde aus allen Richtungen schnell erkennen konnte. 1962 ging eine Materialseilbahn in Betrieb, was die Versorgung viel einfacher machte.
Über Umwege kam die Hütte dann schließlich zur Familie Datz: „Mein Opa kannte die drei Frauen vom Kneifellehen. Am Stammtisch hat er dann mitbekommen, dass sie die Hütte verkaufen möchten und sich angeboten. Mein Opa kaufte sie ursprünglich für meinen Onkel. Der war Brauer und der Opa dachte, das passt gut zusammen. Tatsächlich war mein Onkel aber eher ein introvertierter Mensch und konnte gar nichts mit den viele Gästen anfangen. Schließlich hat mein Papa sie übernommen. Das war ganz schön mutig. Immerhin hatten meine Eltern bereits einen Kiosk am Salzbergwerk, der sehr gut lief aber viel Arbeit war.“ Den Kiosk gibt es noch immer, ihn führt heute Ulis Schwester Eva weiter.
Früher hat Papa Franz die Forststraße immer selbst mit dem Unimog geräumt. Das sei für ihn das Größte gewesen, bei Sauwetter den Weg frei machen, oben einheizen und dann warten, bis jemand vorbeikommt, erzählt Uli. „Heute rechnet sich das nicht mehr. Wir haben zwar eine Solaranlage, heizen aber mit Gas. Das Haus ist in erster Linie für den Sommer gebaut und man bräuchte zu viel Energie, um alles warm zu bekommen. Außerdem müsste ich jede Fahrt mit dem Schneepflug bezahlen. Das steht nicht dafür. Und wir brauchen einfach unsere Ruhephase“.

Ulis Mama Reserl war alles andere als erfreut darüber, als ihr Mann die Hütte kaufte. „Sie wusste sofort, dass viel Arbeit auf Sie zukommt. Schließlich stand da 1972 nur eine Bretterburg mit zwei Tischen und ein paar Stühlen auf einer provisorischen Terrasse.“ In den Anfängen trug Reserl das Essen zur Seilbahn und stieg danach zu Fuß hinauf. Jeden Tag. Franz wartete oben, bereit zum Ausladen. „Schließlich hat der Papa eine Forststraße durch den Wald gebaut, Felsen weg gesprengt. Als die Straße fertig war, ging die Bauphase oben weiter. Er hat die Terrasse ausgeweitet und erneuert und schließlich das Gasthaus errichtet, so wie es heute dasteht.“ Ein Sommer lang jeden Tag Arbeit, im Herbst 1975 dann die Eröffnung. Der schmale Serpentinenpfad, den schon Ulis Mama gegangen ist, ist heute noch immer Teil des Hauptweges auf die Kneifelspitze. Anfangs haben die Leute unten im Tal den Franz belächelt. Sich gefragt, wieso er sich die ganze Arbeit antut und ob sich das überhaupt lohnt. Als sie dann oben waren, haben sie gesehen, wie schön es geworden ist. Und dann sind sie immer wieder gekommen.
„Als Kind hatte ich nie wirklich Ferien. Ich war immer hier oben, habe gearbeitet, auch nach der Schule. Das war halt so. Dafür hatten wir es im Winter wunderschön. Die Eltern waren daheim, wir waren Skifahren und hatten ganz viel Zeit.“ Sagt Uli. Zeit, die sie sich auch heute noch in den Wintermonaten nimmt.


Anekdoten von früher bis heute
In den über 50 Jahren ändert sich einiges am Berg, meint Uli. „Früher hatten wir viele Stammgäste, die alle ihren festen Stammtisch hatten. Ich erinnere mich noch, dass am Freitag Nachmittag immer dieselben Leute nach der Arbeit da waren und bis abends gesessen sind. Jede Woche, bei jedem Wetter“, sagt Uli. Das habe sich vor gut 15 bis 20 Jahren aufgelöst. „Die Alten können nicht mehr oder sind gestorben und die Jungen wollen sich nicht festlegen. Nicht jede Woche zur selben Zeit am selben Ort sein. Ich bin ja genauso“, erzählt die 56-jährige. Stattdessen kommen Wanderer oft spontan, wegen der Aussicht, oder wenn der erste Schnee weg ist und die Schneerosen blühen. Ein magischer Anziehungspunkt, vor allem für Hobbyfotografen.
In den über 50 Jahren, in denen Uli hier schon oben ist, hat sie die verrücktesten Geschichten erlebt. Von Urlaubern, die zwar raufkamen, sich aber vom runtergehen fürchteten, jenen, die trotz Verbotsschild mit dem Auto direkt nach oben fuhren oder andere, die davon ausgehen, dass die Wirtin Handtücher verleiht, weil man nach einer Wanderung schließlich schwitzt. „Ich hatte hier oben auch schon Leute mit Klettergurt, Helm und einem riesigen Rucksack für gefühlt drei Wochen Arktis, die mich fragten, wo es denn zum Gipfel geht“, erzählt die Wirtin und lacht laut auf. „Aber du glaubst ja nicht, was die Leute alles mitnehmen. Die klauen Gläser, Klopapier, alte Bergschuhe, die eigentlich als Deko an der Wand hängen und sogar Klobürsten. Ich frag mich oft, was die wohl damit machen. Die Gäste sind schon manchmal kurios, aber im Grunde alle sehr lieb.“
Routinen ändern sich
Die Küche auf der Paulshütte war schon immer gut bürgerlich. Schmecken soll es, aber auch einfach bleiben. In der kleinen Küche bleibt schließlich nicht viel Platz für aufwendige Gerichte. Die Kuchen bereitet Uli vor, wenn Zeit dafür ist. Dann macht sie Blech um Blech und friert alles in den großen Truhen ein. Es wäre undenkbar auch einem langen Arbeitstag jeden Abend noch mehrere Kuchen zu backen. Zumal die Wirtin nach Feierabend auch die gesamte Gaststätte inklusive Toiletten alleine putzt.
Der Chef in der Küche ist heute ihr Mann Sigi. Auch er kocht viel vor, zum Beispiel seine Knödelvariationen mit Spinat, Käse oder Rote Beete. „Bei uns gibt es nichts was lang dauert. Also kein Schnitzel oder Kaiserschmarrn.“ Als gelernter Koch betrieb Sigi das Wirtshaus Bachgütl in Maria Gern, war auf Saison in der Schweiz. Erst als Ulis Mama 2020 nicht mehr konnte, übernahm Sigi die Küche in der Paulshütte. „Beide gleichzeitig als Köche, das hätte nicht funktioniert“, sagt Uli „Die Küche war Mamas Reich, den Platz hätte sie nicht hergegeben. Dort hat sie Erbsensuppe und Gulasch mit ihren berühmten Knödeln gekocht bis sie über 80 war.“ Als das Reserl nicht mehr konnte, war klar, jetzt kommt der Sigi mit. Das war 2021.

Auf der Terrasse ist es ruhig geworden. Uli ist jetzt alleine oben, lehnt die schweren Eisenstühle an die Tische und fährt die Rollos an den Fenstern nach unten.
Ein paar Sonnenstrahlen blitzen zwischen den Wolken hindurch und fallen auf das kleine Gipfelkreuz, das inmitten von Latschen auf der Terrasse steht. „Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land“, steht dort auf einer hölzernen Tafel geschrieben. Ein Spruch von Ludwig Ganghofer, der hier auf der Kneife so gut passt wie nirgendwo anders.